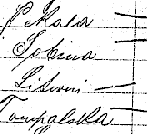|
Ende des Krieges und Gefangenschaft
Mit Rücksicht auf die Kosaken setzte sich die Schwadron und das Regiment ab Januar 1945 in Richtung Österreich ab. Die Nachricht von der deutschen Kapitulation erreichte sie im Städtchen Franz in der Steiermark. Einige Tage später gaben alle ihre Waffen bei den Engländern ab. Es ging damals sogar das Gerücht um, daß man General von Pannwitz versprochen habe, alle in englische Gefangenschaft zu nehmen. Die ganze Division wurde nun in einem Talkessel zusammengezogen. Als dieses Lager aufgelöst wurde, und alle Soldaten auf schwere Militärlastwagen verladen wurden, hofften viele noch auf eine baldige Rückkehr in die Heimat, doch ließen die MG-Posten längs der Straße, die begleitenden Panzerspähwagen und die stark bewaffneten englischen Bewacher erste Zweifel an einen guten Ausgang aufkommen. Sicherheitshalber wurden Orden und Abzeichen weggeworfen. Einige verzweifelte Kameraden sprangen sogar von den Lastwagen und wurden sofort erschossen. Im Städtchen Judenburg an der Mur stand die Bevölkerung Spalier, als die Wagen ihre Fahrt verlangsamten und vor einer Brücke kurz anhielten. Der Fluß bildete die Demarkationslinie. Im Schrittempo überquerten die vielen Wagen die Brücke. Auf der anderen Seite warteten die Russen auf die auszuliefernden Gefangenen. Als Otto Sobina - wie die anderen - vom Fahrzeug sprang, stürzte sich eine Meute schwerbewaffneter Russen, die teilweise unter Alkohol standen und zum Fürchten aussahen, auf die Gefangenen. In diesen entscheidenden Minuten überfiel den Gefangenen Otto Sobina die Angst, wohl niemals mehr Frau und Sohn wiederzusehen, doch zunächst nahm man ihm nur die Zigaretten, den Tabak und ein Paar Schuhe ab. Solange die Engländer zusahen, versuchten die Russen noch, sich zu beherrschen. Das änderte sich aber schlagartig, als die Engländer ans andere Ufer zurückfuhren. Mit erhobenen Machinenpistolen und 'dawai, dawai' wurden alle in eine nahe Fabrikhalle getrieben. Dort erst erfolgte dann die gründliche Leibes- und Gepäckvisitation. Als dann eine tiefe Grube ausgehoben wurde, dachte auch Otto Sobina an das Schlimmste. Am Abend bestand dann aber Klarheit über den Zweck der Grube: Es wurde eine Latrine. Da die von den Engländern vorsorglich oder zur Täuschung mitgegebene Verpflegung gleich von den Russen eingesammelt worden war, wurde nun erstmals gehungert.
Anfang Juni wurde eine Verlegung nach Graz angekündigt. Da die Bahn aber noch nicht richtig funktionierte, sollte die Strecke im Fußmarsch zurückgelegt werden. Bei sommerlicher Hitze, begleitet von Wachmannschaften mit aufgepflanzten Bajonetten, ging es ungefähr zehn Kilometer, dann wurde wieder kehrtgemacht. Campiert wurde unter freiem Himmel in einem Tierpferch in der Nähe des Bahnhofs. Aus Angst vergrub Otto Sobina hier seine bis dahin gerettete Dienstuhr. Am nächsten Morgen wurden die Gefangenen in viel zu wenige Waggons Körper an Körper gepreßt. Bei verschlossenen Luftluken und zugenagelten Türen war es bei sommerlichen Außentemperaturen in den Waggons unerträglich. Hoffnungslosigkeit prägten die Gedanken des Otto Sobina. In Graz wurden alle Gefangenen in einem Zuchthaus untergebracht und kahlgeschoren. Nun war auch Otto Sobina unwiderruflich ein "Woina Plenni" (Kriegsgefangener). Ungefähr zwei Wochen dauerte der Aufenthalt in Graz. Die Gefangenen wurden zwar nicht zur Arbeit gezwungen, dafür aber des öfteren gefilzt, um auch noch der letzten Habseligkeiten beraubt zu werden.
An einem schönen Junimorgen wurden dann alle in einen Transportzug gesteckt. Sämtliche Luft- und Lichtluken waren zugenagelt und mit Stacheldraht gesichert. Auf jedem zweiten Waggon hatte man einen Postenstand eingerichtet. In den Waggons war in der Bodenmitte ein Loch gebohrt mit einem Holzgestell darüber, das war das Klo. Da es keine Pritschen im Waggon gab, konnten die Gefangenen nur herumstehen oder sich mit angezogenen Beinen auf den Boden kauern. Strohsäcke oder wenigstens loses Stroh gab es auch nicht, und nur einige Kameraden hatten ihre Decken retten können. Nachts legten sich die ungefähr vierzig Mann wie Löffel in einem Besteckkasten auf den nackten Boden und ab und zu drehte sich dann die ganze Mannschaft gleichzeitig auf die andere Körperseite. Die Verpflegung kam noch aus deutschen Beständen und wurde etwa zweimal täglich verabreicht: Erbsen mit ungefähr 600 Gramm trockenem Brot und vielleicht 10 Gramm Zucker. Nun beneidete mancher Kamerad den Otto Sobina mit seiner Körperfülle. Schlimmer als der Hunger war für ihn der Durst in der stickigen Luft des Waggons bei hochsommerlichen Außentemperaturen von 30° bis 40° C. Nur bei Aufenthalten bekamen die Gefangenen etwas Wasser, aber nur zum Trinken, nicht zum Waschen. Otto Sobina hatte sich einen Stammplatz an der rechten Außenwand ergattert und mit Geduld ein Loch in die Wand gebohrt, das ihm hin und wieder etwas kühle Luft und manchmal auch etwas Regenwasser verschaffte, außerdem einen Ausguck in die vorbeiziehende Landschaft ermöglichte. Einige Kameraden drehten auch seelisch durch, besonders wenn man sich gegenseitig Geschichten über die Vergangenheit erzählte und die Gedanken in die nicht rosige Zukunft schweifen ließ. Ansonsten herrschte trostlose Langeweile, die nur durch das häufige, fast tägliche Abzählen unterbrochen wurde. Das begann jeweils mit einem sorgfältigen Abklopfen des Waggons mittels eines Holzhammers, um zu erkunden, ob nicht irgendwo ein Brett gelöst worden war. Nach dem Öffnen der Tür trieben die Wachposten die Insassen mit Schlägen und Tritten in eine Waggonecke, von der aus dann am zählenden Begleitoffizier vorbeigelaufen werden mußte. Orts- und Bahnhofsschilder verrieten die Fahrtrichtung durch Ungarn und Rumänien.
An der Grenze zur Sowjetunion wurden die "Woina Plennis" in Waggons der russischen Breitspur verladen. Diese russischen Waggons waren in noch schlechterem Zustand als die vorherigen: Die Dächer waren mit Wellblech notdürftig vernagelt und mit Unmengen von Stacheldraht gesichert. Durch die schlecht geflickten Waggonwände kam bei Hitze wenigstens etwas Frischluft, aber bei Regen strömte das Wasser in wahren Sturzbächen in das Innere.
Einige Kameraden wurden seelisch und körperlich krank, und ärztliche Betreuung oder Medikamente gab es natürlich nicht. Otto Sobina war nun froh, daß er von den 105 Kilogramm Lebendgewicht, die er sich nach dem Motto "Kinder genießt den Krieg, der Frieden wird furchtbar" angefuttert hatte, zehren konnte. So befand er sich im Vergleich mit anderen noch in guter körperlicher Verfassung.
Als der Zug nach kurzem Zwischenaufenthalt in Moskau, wo man gerade den Sieg über die Deutschen feierte, weiter nach Osten in Richtung Ural rollte, machte sich Otto Sobina immer mehr mit dem Gedanken vertraut, wie sein Vater in Sibirien zu landen. Erinnerungen an Erzählungen seines Vaters aus dessen Gefangenenzeit in Sibirien wurden immer häufiger wach. Hinter dem Ural zog dann eine eintönige Landschaft an ihm vorbei. Weitläufige, sanfte Hügel soweit sein Auge blicken konnte, nur ab und zu kleine strohgedeckte Holzhäuser mit hochaufragenden Ziehbrunnen. Da die Bahnstrecke nur noch eingleisig war, mußte der Zug oft für unbestimmte Zeit an Ausweichstellen warten. Bei solchen Halts durften sich dann die Gefangenen etwas die Beine vertreten und bekamen manchmal sogar Einheimische zu Gesicht, die in unbeschreiblich zerlumpter Kleidung und mit hungrigen Augen die Gefangenen um etwas Brot baten.
Nach Verlassen der Stadt Nowosibirsk bog der Zug plötzlich von der Hauptstrecke nach Süden ab in das sogenannte Kusnezker Becken. Am 42. Tag seiner Reise war Otto Sobina vorerst am Ziel. Mit rund tausend anderen deutschen Kriegsgefangenen durfte er gut 6000 km von der Heimat entfernt endlich die qualvolle Enge des Waggons vergessen (45). Zwei Kameraden seines Waggons waren unterwegs gestorben, einige, die nun ausstiegen, sahen furchtbar heruntergekommen aus, einige konnten sich kaum auf den Beinen halten. Und auch an Otto Sobina waren die Strapazen der Reise nicht spurlos vorübergegangen: Er hatte 8 kg verloren, und wegen der fehlenden Waschgelegenheit duftete er penetrant, die Haare zerzaust, der gewachsene Bart struppig. Nun stand er da in unsauberer Unterwäsche, halbwegs zerschlissener Jacke und Reithose und dreckigen Stiefeln, den geretteten Wehrmachtsmantel über der Schulter und fühlte sich vom äußeren Erscheinungsbild her wie ein Verbrecher. Sicher hatten sich die am Wegrand stehenden Einheimischen die "gefürchteten Deutschen" anders vorgestellt, als diese nun den ungefähr 300 m langen Weg zum Lager getrieben wurden.
Das erste Lager befand sich an einem sanft abfallenden Hang eines kleinen Hügels, der in ein liebliches Tal auslief. Doch hinter dem wohl 4 m hohen Bretterzaun war nichts als eine öde, leere Fläche. An diesem Abend schlief Otto Sobina im Freien, auf dem blanken Boden und deckte sich mit seinem Militärmantel zu. Der sibirische Sommer kann zwar recht warm sein, doch nachts kühlt es schnell ab.
Am nächsten Tag erfolgte die sogenannte "Kommissionierung". Ein angeblicher Arzt saß an einem Tisch und einer nach dem anderen der Gefangenen mußte splitternackt an ihm vorbeidefilieren. Nach kurzer allgemeiner Musterung kam der entscheidende Test: Der Arzt kniff herzhaft in das Hinterteil und stellte bei Otto Sobina fest: "Pervi Kategoria" (1. Klasse). Damit gehörte Otto Sobina zur ersten Leistungsgruppe und mußte künftig 100 % der Staatsnorm, ganz gleich in welcher Tätigkeit, erfüllen. Doch es kamen bei diesem Test nur wenige in eine leichtere Arbeitsgruppe.
Danach begannen bald die ersten Verhöre, wobei meist weibliche russische Dolmetscher versuchten, das letzte Geständnis aus den Leuten herauszuquetschen. Auch Otto Sobina wurde immer wieder nach genauen Einzelheiten der letzten Zeit befragt: Was genau von Beruf, wo und wann genau im Einsatz, wie lange bei den Kosaken ... Und alles wurde schriftlich festgehalten. Bei diesen peinlichen Verhören mußte er besonders bei Fragen nach kleinsten Kleinigkeiten genau aufpassen und durfte nicht vergessen, was er aussagte, denn er ahnte, daß er sich bei erneuten Verhören nicht widersprechen oder verhaspeln durfte. Da er bei "seinen Kosaken" etwas Russisch gelernt hatte, konnte er sogar korrigierend eingreifen, wenn die Dolmetscherin dem Schreiber etwas anderes diktieren wollte, als er gesagt hatte.
Solange die scheinbar aus Moskau angereiste Untersuchungskommision (mit ihren dunkelblauen Schirmmützen mit roten Rändern, olivgrünen Röcken, dunkelblauen Hosen und gepflegten Lederstiefeln) anwesend war, waren die Verhältnisse im Lager geradezu erträglich: man verschonte die Gefangenen vor schwerer Arbeit und verabreichte ihnen - nach russischen Verhältnissen - sogar fast normales Gefangenenessen. Morgens gab es 1/2 Liter Suppe aus Hafer, Gerste oder Hirse mit 8 Gramm Fett und dazu 200 Gramm feuchtes Schwarzbrot. Mittags wieder 1/2 Liter wässrige Kohlblättersuppe und dazu etwa 150 bis 200 Gramm Kascha (dies war ein knetbarer Brei aus Hafergrütze, Gerste, Hirse oder Sojamehl mit etwa 10 Gramm Fett und einem Fingerhut voll Zucker) und zudem noch 200 Gramm Brot. Abends gab es die Suppenreste vom Morgen, 200 Gramm Brot und 70 Gramm Salzfleisch. Außerdem standen jedem Gefangenen pro Tag 5 Gramm Tabak und pro Monat eineinhalb Schachteln Streichhölzer zu.
Doch gleich nach der Abreise der Kommission sackte Güte und Nahrhaftigkeit der Verpflegung bei seltsamerweise gleicher Gewichtszahl verhängnisvoll nach unten ab. Beim Iwan war eben nur wichtig, was auf dem Papier vermerkt wurde; eine Erkenntnis, die sich Otto Sobina später selbst bei der Soll-Erfüllung zunutze machte.
"Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen" oder umgekehrt. Und so trat recht bald ein, was von allen Gefangenen eigentlich schon erwartet worden war. Otto Sobina wurde zur ersten Fronarbeit auf einer Kolchose eingeteilt. Mit vielen anderen sollte er ein Kartoffelfeld abernten, doch waren die Kartoffelpflanzen unter selbstausgesäter, hochgewachsener Hirse kaum zu finden. Bei der Gelegenheit lernte Otto Sobina auch die Umgebung des Lagers kennen: Das Tal zeigte reizvollen Mischwald und unbearbeiteten Steppenboden, der hier und da von Birken und Büschen unterbrochen war. Beeindruckt war er auch von der herbstlichen Blumenpracht der Steppe, es fiel ihm aber auch auf, daß die meisten Blumen bei aller Farbenpracht nicht dufteten. Bald machte er auch Bekanntschaft mit dem russischen "Machorka" (aus kleingeschnittenen, getrockneten, besonderen Pflanzenstengeln), der aber nur in russischem Zeitungspapier schmeckte, da dies beim Rauchen nicht brannte, sondern nur glomm. Diese selbstgedrehten "Papyrossis" waren für ihn zwar von ungewohntem Geschmack, doch er erkannte bald, welche wichtige Nebenrolle diese "Papyrossis" spielten. Man brauchte sie, wenn man bei der Arbeit eine Pause einlegen wollte, denn kein auch noch so gehässiger Aufpasser brachte es im allgemeinen fertig, einen Gefangenen beim Rauchen zu behelligen. Eine Rauchpause schien in Rußland heilig und unantastbar. "Sa kurim" (laßt uns rauchen) bedeutete soviel wie das Gerät aus der Hand legen, sich hinhocken und legal ausruhen dürfen. Machte man hingegen eine Verschnaufpause ohne zu rauchen, kam man gleich in den Geruch eines "lodr", eines üblen Nichtstuers. Und das oberste Gesetz für einen Gefangenen hieß: Nur nicht unangenehm auffallen!
Einer der nächsten Morgen brachte eine Überraschung: Mit ihren Bündeln zogen die meisten Gefangenen in Fünferreihen durch das Lagertor und marschierten auf einem breiten, unbefestigten Weg hügelauf und -ab durch üppigst blühende sibirische Landschaft. Solche Wege waren dort typisch. Solange es trocken war, waren sie passierbar, bei Regen allerdings verwandelten sie sich im Handumdrehen in schlüpfrige Schlammbahnen.
Nach fast vierzehnstündigem Marsch ohne Essen und mit wenigen kurzen Pausen gelangte Otto Sobina mit den vielen anderen gegen Abend in stärker besiedelte Bezirke. In der Ferne waren zahlreiche Fördertürme mit beträchtlich hohen Abraumhalden zu erkennen. Irgend jemand hatte erfahren, daß dieser weitverzweigte Ort Prokopjewsk oder so hieße und in seiner ganzen Ausdehnung annähernd hunderttausend Einwohner zähle. Das sah man der 'Stadt' aber kaum an. Vor meist kleinen russischen Holzhäusern inmitten kleiner Gärten voller Sonnenblumen, Kartoffel- und Kohlbeeten standen die Bewohner und bestaunten den langen Zug der Gefangenen. Hier und da erhoben sich unvermittelt einige größere Häuser aus dem Gesamtbild, das waren wohl Zechengebäude, staatliche Verwaltungsbauten oder dergleichen. Teilweise sah man auch Reihen neuzeitlich wirkender Siedlungshäuser in zweigeschossiger Bauweise, doch waren diese in unbeschreiblichem Zustand: Türen und Fenster hatten wohl seit ihrem Einbau keine Farbe mehr gesehen, die Fenster waren oft mit Pappe oder Holz zugenagelt oder aus kleinen Glasscherben zusammengesetzt.
Am nächsten Tag stellte Otto Sobina fest, daß das neue Lager sich ziemlich am Rande des Siedlungsgebietes von Prokopjewsk befand, am sanft ansteigenden Hang eines Hügels. In großer Entfernung konnte er im Süden das Altaigebirge mit seinen schneebedeckten hochaufragenden Gipfeln sehen.
Doch das Lager interessierte ihn vorerst mehr. Es bestand aus mehreren langen Fachwerkbaracken. Betrat man diese Baracken, so kam man in einen langen Gang, von dem rechts und links ungefähr 4m x 4m große Räume abgingen, die alle ganz gleich aussahen. Kam man zur Tür herein, stand gleich rechts der Ofen. An den restlichen Wänden standen Holzgestelle zum Schlafen. In der Mitte stand ein kleiner Tisch mit 4 Hockern, darüber baumelte die Glühbirne von der Decke. Außerdem war an der Wand ein Brett mit Nägeln für die Kleidung angebracht. Und zudem gab es in jedem Raum unzähliges Ungeziefer, von Wanzen bis zu Ratten. Später sollte sich herausstellen, daß die Ratten durchaus nützliche Haustiere waren. Band man sich nämlich alle Kleidungsöffnungen (Hosenbeine, Ärmel usw) vor dem Schlafengehen zu, dienten sie gerne als lebende Wärmflaschen. Je mehr Ratten man hatte, umso weniger fror man in der Nacht, behauptete später Otto Sobina.
Die Vorbewohner dieses Lagers waren Volksdeutsche gewesen, die man nach Beginn des deutsch-russischen Krieges hierher verschleppt hatte, und die man nun nach dem Eintreffen der vielen deutschen Kriegsgefangenen in die nächstniedrigere Strafstufe befördert hatte. Bisher hatten sie in diesem Lager leben müssen und wurden bei der Arbeit scharf bewacht. Nun durften sie draußen in der Stadt wohnen und sich sogar im Umkreis von 15 km frei bewegen.
Bald nach der Belegung der Räume erfolgte eine erneute Taxierung mit der schon bekannten Hinterteilprüfung: "Vot haroschij Schachtior" (Welch ein guter Schachtarbeiter) und "Skoro ti budisch Schachti rabotat" (Bald wirst Du im Schacht arbeiten)! Entsprechend dieser positiven Feststellungen erfolgte anschließend die Arbeitsvergabe. Otto Sobina wurde wegen seines guten körperlichen Zustands zur Arbeit im Woroshilow-Schacht verdonnert. Mehr als die Hälfte der anderen Gefangenen traf das gleiche Glück!
In der Folgezeit sah für ihn ein Arbeitstag dem anderen gleich:
4.30 h aufstehen, schnell das Essen empfangen und runterschlingen, denn schon um 5 h wurde zum Abmarsch Richtung Schacht gerufen. Der Marsch zum Schacht, begleitet von bewaffneten Posten mit Hunden, nahm etwa eine Stunde in Anspruch und war schon eine Anstrengung, besonders bei Regen und im Winter, wenn der Weg fast unbegehbar war und ein eisiger Wind pfiff. Endlich beim Schacht angekommen, ging es mit "dawei" in den Umkleideraum, wo die Oberbekleidung gegen die Arbeitskleidung ausgewechselt wurde. Auch die Grubenlampen mit Batterien wurden verteilt. Danach ging es zum Fahrstuhl, wo auch Otto Sobina meistens etwas warten mußte und verschnaufen konnte, bis er an der Reihe war. Er hat während dieser kurzen Pause auch oft an das ungewisse Schicksal von Frau und Sohn gedacht und gebetet, daß er nach der achtstündigen, ungewohnten Arbeit im Stollen wieder gesund ans Tageslicht kommen dürfe. Unten angekommen, mußte sich das Auge erst an die Dunkelheit gewöhnen. Bis zum direkten Arbeitsplatz mußte er dann noch 1 1/2 bis 2 km laufen. Auch dieser Marsch war nicht sehr einfach. Es war schwierig, mit den rutschigen Gummigaloschen die schmalen Bohlen, die zwischen den Gleisen der schmalen Grubenbahn lagen, nicht zu verfehlen. Und man mußte höllisch aufpassen, denn urplötzlich donnerte ein Grubenzug vorbei, und manchmal sprangen auch Loren aus den verrotteten Gleisen. Am Arbeitsplatz angekommen, wurde vom russischen Steiger die Tagesarbeit zugeteilt. Zuerst mußte die meist von der vorherigen Schicht liegengelassene Kohle in gebückter Haltung mit riesigen Schaufeln an extra kurzen Stielen fortgeschafft werden, teils direkt in die Loren, teils in Schächte, die die Kohle ein Stockwerk tiefer in solche Loren poltern ließ. Unterdessen hatte der Steiger an der Stirnwand die Stellen angezeichnet, wo gebohrt werden sollte. Dann wurden mit einem Preßlufthammer und einem 1 1/2 Meter langen Steinbohrer fünf bis sechs Löcher gebohrt. Waren die Löcher fertig, kam der Sprengmeister oder die Sprengmeisterin und füllte sie mit Sprengkapseln. Bei der Sprengung mußten alle den Stollen verlassen. Danach ging es aber, nachdem sich Staub- und Gaswolken etwas gelegt hatten, gleich wieder an die Arbeit: Drei Mann mußten die Kohlen abfahren, zwei Mann mußten die Seitenwände und die Decke glätten, zwei Mann mußten Rundholz und Bretter herbeibringen, die restlichen zwei Mann haben dann die Seitenwände und die Decke Schritt für Schritt eingeschalt. Wenn alles fertig war, waren die unfreiwilligen 'Kumpels' körperlich und seelisch geschafft. Nun stand Otto Sobina, seinen besonderen Kameraden Stampe, Haist und Sagromsky und den anderen noch der Weg bis zum Förderturm bevor. Oft wurden sie dann oben von den Russen begrüßt mit der Frage "Kamerad, na verch karosch" (Kamerad, ist es oben nicht schön)?
Nach dem Abduschen des Kohlestaubs und dem Wechsel der schmutzigen Arbeitskleidung gegen die ebenso schmutzige Lagerkleidung ist dann auch der noch kräftige Otto Sobina müde ins Lager getorkelt, natürlich alles unter Bewachung. Um 16 Uhr gab es dann das sogenannte Mittagessen, das aus zwei Wassersuppen und 400 Gramm Brot bestand. Zwei Stunden später folgte das ebenso karge Abendessen, unter anderem manchmal auch 'Quass' (das ist gesäuertes Mehl oder Bierhefe mit Wasser, eben so eine Art leichtes Bier). Anschließend fiel Otto Sobina meist todmüde ins Bett.
Und das Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat!
Es gab drei Schichten: von 6 Uhr bis 14 Uhr, von 14 Uhr bis 22 Uhr und von 22 Uhr bis 6 Uhr.
Und dann kam das erste Weihnachtsfest in Sibirien. Ein eisiger Nordwind wehte um das Lager, die Außentemperatur betrug ungefähr minus 32° C. Im Raum von Otto Sobina war es aber wohlig warm, denn er hatte aus dem Schacht immer wieder einige Kohlebrocken organisiert, rausgeschmuggelt. Das war zwar verboten - und wer erwischt wurde, kam für ein paar Tage in den Karzer -, aber es wurde viel im Lager 'organisiert'. So hatten auch einige Kameraden sauberes Maschinen-Öl 'organisiert', andere hatten mit Preßlufthämmern ein paar Kartoffeln aus dem tiefgefrorenen Boden geholt. Die Kartoffeln waren glasig, das Öl schmeckte seltsam, aber es war für alle Stubenkameraden ein kalorienreiches Festtagsessen. Schwermütige Gedanken gingen Otto Sobina durch den Kopf und es war wohl gut, daß er an diesem 'Heiligabend' nicht ahnte, wie oft er noch Weihnachten in Sibirien verbringen sollte. Nur ein eiserner Wille und der feste Glauben, eines Tages doch nach Hause zu kommen, gaben Otto Sobina die Kraft und den Mut zum Durchhalten.
In der Neujahrsnacht 1945/1946 sollten Otto Sobina und die anderen Männer der Schichtgruppe, die immer wieder mal anders zusammengestellt wurde, den Stollen wie üblich zwei Meter vorantreiben, als ungefähr um Mitternacht die Preßluft ausging, was bedeutete, daß irgendwo in der Grube ein Unglück geschehen sein mußte. Bis zum Ausstiegschacht sind sie noch gekommen, doch da war schon alles dicht. Unter den Russen brach ein panikartiger Tumult aus. So schnell es ging, kämpften sich die Gefangenen bis zum Notausstiegsschacht (es gab an vielen Stellen kleine Vertikalschächte zur Belüftung, zur Versorgung der Horizontalstollen mit Grubenholz usw.) vor, mußten dann aber entsetzt feststellen, daß an der Leiter fast alle Sprossen fehlten. Sie hätten es wissen müssen, denn nirgends im Lager war etwas wirklich in Ordnung; vieles verrottete still vor sich hin. So mußten sie bei Kälte und durchnäßter Kleidung mehr als zwei Stunden warten, bis man sie aus dieser mißlichen Lage befreite. Es war auch für Otto Sobina ein recht unbehaglicher Zustand, denn die ungefähr fünfuig und mehr Meter dicke Erdschicht über ihm hätte jederzeit auf ihn stürzen können.
Daraus wird erkennbar, daß Überraschungen im Alltag eines Kriegsgefangenen in der Regel negativ ausfielen. So war auch Otto Sobina eigentlich in gewissem Sinne schon froh, wenn jeder Tag wie der vorhergehende verlief und nicht mit zusätzlichen, unangenehmen Besonderheiten aufwartete.
Eine freudige Überraschung gab es allerdings im Frühjahr 1947. Es wurden Postkarten verteilt, um Kontakt mit den Familien aufnehmen zu können. Es durften nur 25 Wörter geschrieben werden, und außerdem nur Positives. Auch Otto Sobina mühte sich ab, diese Forderungen zu erfüllen, bezweifelte aber, daß diese Karte tatsächlich in der Heimat ankommen würde, wußte er doch nicht einmal, ob die alte Anschrift in Beuthen noch galt. Aber sie muß trotzdem irgendwie angekommen sein, denn seit Sommer 1947 wußte Hildegard Sobina, daß ihr Mann im sowjetischen Lager Nr.7525/13 war und die Kennziffer 61548 hatte.
Dank der Menge und Güte der Verpflegung (zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig) in Verbindung mit der schweren Schachtarbeit hatte es der Iwan dann gegen Ostern 1947 doch geschafft, Otto Sobina auf 48 kg Haut und Knochen abzuspecken. Da auch die Russen diese Unterernährung nicht leugnen konnten, wurde Otto Sobina für ein halbes Jahr ins Lazarett geschickt. Das war zunächst eine zweifelhafte Gnade, denn unter den Gefangenen wurde das Lazarett oft als "Wartesaal des Todes" bezeichnet. Im Lazarett war aber zumindest die Verpflegung etwas besser. Während andere teilweise nur faul rumlagen oder auch wirklich nicht mehr konnten, sah sich Otto Sobina nach einer sinnvollen Beschäftigung um. Zunächst hat er sich beim Arzt als 'Diener' angeboten, dessen Stube immer schön geputzt ... und sich so ganz nebenbei an dessen Brotportion gehalten. Zusätzlich hat Otto Sobina dann noch jeden Tag von 20 Uhr bis 24 Uhr beim Wachoffizier 'Ordonanz' gemacht. Um 22 Uhr hat er zum Beispiel das Essen für den 'Herrn Offizier' geholt und dabei durch reichliche Kostproben festgestellt, daß es bedeutend besser war als das der Gefangenen. So schlug sich Otto Sobina durch, kam ganz gut über die Zeit hinweg und hat sich auch zufriedenstellend erholt.
Nach dieser Erholungspause hatte Otto Sobina Glück, dem er durch Beziehungen zum Arzt und Wachoffizier etwas nachhalf, denn angesichts seines Berufes wurde er ab November 1947 der Bauschmiede zugeteilt. Dort mußten offiziell Bauklammern, Nägel und anderes Bedarfsmaterial für die Gruben geschmiedet werden. In der Zwischenzeit hatte Otto Sobina aber das russische Arbeitsprinzip durchschaut und mit etwas Geschick gelang es ihm, fertiges Material des Vortages erneut zu erwärmen und bei der täglichen Soll-Überprüfung vorzulegen. So brachte er es bald auf eine 150%-ige Normerfüllung. Für diesen Fleiß bekam er als Anerkennung schon bald einen neuen blauen Arbeitsanzug, den er aber gleich für 4 Rubel an einen armen Zivilisten verscherbelte. Wesentlich erträglicher für ihn waren Nebentätigkeiten für höhergestellte Iwans. Besonders begehrt bei den russischen Offizieren waren seine schmiedeeisernen, schön verschnörkelten Bettgestelle (das Material stellten ihm die Offiziere aus den Zuteilungen, die eigentlich fürs Lager bestimmt waren, zur Verfügung!). Sie bezahlten ihn mit Geld und Naturalien. Für seine gediegenen Schlitten bekam er Brot, Tabak, Hirse und was die Leute eben so anbieten konnten. Außerdem fertigte er für die bedauernswerten Lagerarbeiter ordentliches Werkzeug, zum Beispiel eine Art Kombizange und kleine Hämmerchen für die Glaser. Selbst für die Ärzte schmiedete er auf Bestellung brauchbares Arztbesteck. Damals entwickelte Otto Sobina auch ungeahnte Fähigkeiten im Tauschgeschäft mit dem Lagerpersonal und den Zivilrussen, und im Vergleich zu anderen Kameraden ging es ihm direkt gut. Handwerk hat eben goldenen Boden, dachte er sich, und schmiedete eifrig weiter.
Doch die Tage gingen ins Land und ein Ende der Gefangenschaft war nicht in Sicht, selbst wenn ihm auf die diesbetreffenden Fragen immer mit "skora domoi" (bald nach Hause) geantwortet wurde. Das Jahr 1948 war zwar von der Sowjet-Regierung zum "Jahr der Heimkehr" erklärt worden, doch änderte sich für Otto Sobina dadurch nichts. Wurde er bis dahin als 'Bandit' eingestuft, der Kosaken geführt hatte und dafür büßen sollte, so wurde er nun auch im Lager als offizieller 'Kriegsgefangener' geführt. Ab Mai 1948 gab es im Lager auch eine Art Zeitung, sogar in deutscher Sprache. Die Inhalte waren zwar stark sowjetisch beeinflußt, aber so erhielten die Gefangenen wenigstens erste spärliche Nachrichten über die Situation in der Welt und vor allem in der Heimat. In diesem Jahr erhielt Otto Sobina auch die erste Karte von seiner Frau. Nun wußte er, daß Frau und Sohn die Kriegswirren überlebt hatten und mit seinen Schwiegereltern in Pieskow am Scharmützelsee wohnten - und auf die Karte war sogar ein Foto von Frau und Sohn geklebt (47). Nun hatte er endlich etwas, woran er sich in Stunden der Bedrängnis klammern konnte. Er schrieb sooft als erlaubt, beklagte sich sogar, daß er nicht öfters Post von seiner Frau erhielt (48). Doch ob alle geschriebenen Karten wirklich an ihrem Zielort ankamen, wußte natürlich auch Otto nicht.
Eine weitere Ernüchterung folgte bald, als man ihn nach erneuten Verhören (Scheinwerfer, Dolmetscherin, Drohungen mit Einzelhaft) zu weiteren 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilen wollte. Das war ein Schlag! Da brauchte man starke Nerven! Otto Sobina setzte alles auf eine Karte. Er verzichtete auf die Dolmetscherin und übernahm selbst seine Verteidigung. Und er hatte in den zurückliegenden Jahren gelernt, daß gegenüber Russen oft nur Frechheit siegt. Nichts schadet dem Ansehen oder der Respektierung eines Menschen beim Russen mehr, als Unentschlossenheit, Zaghaftigkeit oder gar Feigheit. Wurde er angebrüllt, brüllte er lauter zurück, hatte der Kommissions-Vorsitzende geflucht, hatte er noch ein paar stärkere Flüche auf Lager ... ja er hatte viel dazugelernt. Und tatsächlich ging es diesmal gut aus. Als die Kommission merkte, daß sie bei Otto Sobina auf Granit biß, entließ sie ihn mit den Worten "idi Faschist", verzichtete sogar zunächst auf eine weitere Verurteilung.
Anschließend ging das tägliche Einerlei in seiner trostlosen Regelmäßigkeit weiter, Monat für Monat!
Da erschien im Spätjahr 1949 wieder einmal eine Kommission. Kundige Gefangene wußten schon Tage vorher, wenn eine Kommission im Anzug war. Plötzlich wurde das Personal und die Wachmannschaft erstaunlich freundlich, das Essen wurde reichhaltiger, man erkundigte sich sogar "Supp karosch" (Suppe gut)?, das Lager wurde aufgeräumt und geputzt, Wanzen mit weißer Farbe überstrichen usw. (Selbstverständlich wurde nach dem Abreisen der Kommission alles wieder umgekehrt, und was vorher in der Suppe zu finden war, wurde danach konsequent eingespart). Wieder wurde Nacht für Nacht vernommen. Auch Otto Sobina kam wieder an die Reihe, und wie üblich wurden die gleichen verfänglichen und scheinbar völlig nebensächlichen Fragen gestellt, alles in der Absicht, den Angeklagten in Widersprüche zu verwickeln. Otto Sobina traute seinen Ohren nicht, als ihm abschließend mitgeteilt wurde, daß er für den nächsten 'Heimtransport' vorgesehen sei! Doch er wußte auch, daß man dem Iwan nicht so schnell trauen konnte.
Dennoch fing er an, sich etwas für die 'Heimreise' vorzubereiten. Zunächst einmal besorgte er sich eine Holzkiste und richtete sie als "Koffer" her (49). Und er überprüfte seinen Rubel-Kontostand! Das war nämlich so: Jeder Kriegsgefangene, der sein Soll 100%-ig erfüllt hatte, erhielt offiziell einen Monatslohn von 600 Rubel, die die Lagerverwaltung aber für Kost, Unterbringung und Bekleidung gleich einbehielt. Inbegriffen war auch ein Betrag für Wiedergutmachung und Reparationskosten. Hatte der Gefangene mehr als zu 100% sein Soll erfüllt, gab es zusätzliche Rubel, von denen aber höchstens 100 Rubel ausbezahlt wurden, der Rest wurde auf einem Konto gutgeschrieben. Mit den ausbezahlten 100 Rubel hat man üblicherweise die Verpflegung aufgebessert. Nach eigener Buchführung hatte Otto Sobina im November 1949 ganze 400 Rubel auf seinem Konto. Als er den Betrag abheben wollte, zahlte man ihm aber nur 300 Rubel aus. Er reklamierte energisch. Man meinte daraufhin, daß man es genau überprüfen müsse, wenn er darauf bestünde ... das könnte aber dauern, und er käme dann sicher nicht mehr für den nächsten Transport in Frage. Zähneknirschend ließ sich Otto Sobina die 300 Rubel ausbezahlen. Für 200 Rubel hat er sich mit Reiseproviant eingedeckt: Weißbrot, Wurst, Zucker und Rauchwaren. Diese Marschverpflegung verstaute er in seinem Koffer. Je 50 Rubel hat Otto Sobina an zwei Kameraden ausgeliehen, die nicht über Barmittel verfügten, und sich doch auch etwas Proviant kaufen wollten. (Es wurde Rückzahlung nach der Rückkehr in der Heimat vereinbart. Der eine hat Otto tatsächlich gleich nach der Heimkehr 50 DM gezahlt, der andere wollte erst den Umrechnungskurs wissen, den es damals überhaupt nicht gab. Es gab also auch solche Kameraden; die 50 Rubel waren verloren).
Und dann kam nach vier Jahren Zwangsarbeit im Lager Prokopjewsk der unvergeßliche Tag der Abreise und des Abschieds von den noch zurückbleibenden Kameraden. Am 22. Dezember 1949 wurde Otto Sobina mit den anderen, versehen mit Wattejacke, -hose und -mütze mit Nasenschutz und Filzstiefeln (der üblichen Winterkleidung), in Stalinsk verladen, und die Fahrt ging tatsächlich westwärts. Der Transportzug sah allerdings etwas anders aus als der, mit dem die Gefangenen vor Jahren ostwärts gefahren wurden. Die Güterwagen hatten sogar Pritschen, eine Strohschüttung und einen Ofen in der Mitte. Dieser strahlte bei einer Außentemperatur von minus 25° bis minus 30° wenigstens etwas Wärme aus. Und man hätte sogar die Waggontüren öffnen dürfen, was aber bei der Kälte selten geschah. Otto Sobina konnte es noch nicht glauben, erwartete vielmehr immer wieder den Befehl zur Umkehr. In Swerdlowsk, der größten Stadt des Urals, wurden alle Gefangenen ausgeladen und zur Wäsche und Entlausung in eine Badeanstalt gebracht. Otto Sobina nahm es als Zeichen dafür, daß er sich wohl doch langsam der zivilisierten Welt näherte. Zu Neujahr war der Transportzug bereits in Moskau, und die Fahrt ging immer noch westwärts. Otto fühlte sich nun schon richtig als "Heimkehrer" und die Stimmung wurde mit jedem Kilometer besser. Auch die Bewachung war nicht mehr so streng. Welcher Gefangener wäre auch auf die Idee gekommen, jetzt abzuhauen?
Bald wurden die Gefangenen bei einem Zugwechsel von Breitspur auf Normalspur offiziell an die Polen übergeben. Die Bewachung der Gefangenen wurde nun von Polen übernommen. Für die sowjetische Zugbegleitung hatte man extra einen Personenwagen an den Zug angehängt, in dem sich dann die Russen auch während der Fahrt durch Polen aufhielten. Der Zug rollte weiter, vorbei an ehemals deutschen Städten und Dörfern, deren Bahnhöfe aber alle leerstanden. Am 17. Januar 1950 traf der Transportzug dann in Frankfurt/Oder ein. Als Otto Sobina entsprechende Sperren mit erneuten Kontrollen erkannte, war ihm alles egal. Er warf seinen jahrelang wohlgehüteten Wehrpaß weg, um sich nicht zuletzt doch noch durch irgendeine Unvorsichtigkeit eine Rückfahrkarte einzuhandeln. Auch der goldene Ehering, den er all die Jahre zwischen den Gesäßbacken versteckt hatte, wurde weggeworfen. Und dann war Otto Sobina nach 4 Jahren, 8 Monaten und einer Woche endlich wieder ein halbwegs freier Mann (50). Schnell schickte er ein Telegramm an seinen Schwiegervater Rudolf Behning. Seine Anschrift wußte Otto von den Karten, die ihm seine Frau geschickt hatte. Die letzte Karte enthielt zwar die verschlüsselte Mitteilung, daß er sich in die amerikanische Zone, nach Mannheim, ausliefern lassen sollte, aber er wußte natürlich nicht, daß Frau und Sohn seit November 1949 nicht mehr in Pieskow wohnten. Der Schwiegervater kam auch sofort und gab ihm nähere Informationen zum Stand der Dinge. Während einige Kameraden in der sowjetischen Besatzungszone bleiben wollten, ließ sich Otto Sobina in die amerikanische Zone weitertransportieren. Vorher mußte er aber noch ein weiteres, mißtrauisches Verhör über den Grund und das Ziel seines Reisewunsches über sich ergehen lassen. Die Weiterreise von Frankfurt/Oder nach Süden ließ ihn viel sehen, wovon er jahrelang abgeschnitten war; er mußte es erst in seinem Innern verarbeiten.
Am 18. Januar 1950 traf Otto Sobina in Ulm/Donau ein, wo er zunächst wieder einmal verhört wurde, diesmal aber von Amerikanern. Diese interessierten sich besonders für Auskünfte über die Lage der Gruben und Fabriken, über die Straßenverhältnisse usw. Aber Otto wollte nicht mehr daran erinnert werden und schwieg so weitestgehend. Dann ging es ab ins Übergangslager, wo er mit einem Lodenmantel, einem Anzug, einem Hemd, Unterwäsche und einem Paar Schuhe eingekleidet wurde und ein Handgeld von 50 DM erhielt. Erst jetzt fühlte er sich wirklich als freier Mann.
|